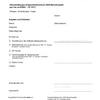Schwerpunkte
Das Endoprothetikzentrum ist spezialisiert auf die Durchführung von Gelenkersatzoperationen an Hüfte und Knie. Hierbei kommen modernste minimalinvasive Verfahren zum Einsatz. Einen weiteren Schwerpunkt des Endoprothetikzentrums bildet die Revisionschirugie, also die Korrektur und der Austausch von Kunstgelenken. Gerne werden wir Sie beraten, wenn Sie Probleme mit Ihrem Kunstgelenk haben. Wir stehen Ihnen von der Untersuchung und Beratung bis hin zu aufwendigen Wechseloperationen zur Seite. Ebenfalls zum Spektrum gehören gelenkerhaltende Operationen an Hüft- und Kniegelenk. Ein Schwerpunkt liegt hier auf den arthroskopischen Operationen am Kniegelenk inkl. Knorpelersatzverfahren und Kreuzbandersatzverfahren. Des Weiteren werden auch minimalinvasive Korrekturen bei Impingement des Hüftgelenks durchgeführt.

Wichtige Telefonnummern
Sprechstunden:
Montag: 08.30 bis 15.30 Uhr
Freitag: 08:30 bis 12.30 Uhr
Sprechstunde Schulter:
Donnerstag: 10:00 bis 14.00 Uhr
Terminvergabe Sprechstunden:
+49 2552 79-1416
+49 2552 79-1417

Das Hüftgelenk
Das Hüftgelenk ist das zweitgrößte Gelenk des Menschen. Es verbindet das Becken mit dem Oberschenkelknochen. Der Kopf des Oberschenkelknochens ist kugelförmig ausgebildet. Er liegt in einer Vertiefung des Beckenknochens, der sogenannten Hüftgelenkspfanne. Die Gelenke bestehen nicht nur aus Knochen, denn zwischen ihnen gibt es den Knorpel. Er sorgt dafür, dass die Knochen bei jeder Bewegung gut gleiten können.
Eine Erkrankung, welche mit Bewegungseinschränkungen und Schmerzen bei oder nach Belastung einhergeht, ist das sogenannte Femoroacetabuläre Impingement (FAI). Auch bei jungen Menschen kann die Hüfte Ursache von Schmerzen bei sportlichen Aktivitäten sein. Meist liegt kein ausgeprägter Verschleiß zugrunde.
Bei dieser Erkrankung liegt eine knöcherne Fehlbildung vor, die den reibungslosen Ablauf der Gelenkbewegung verhindert. Im häufigsten Fall führt ein Wulst am Schenkelhals dazu, dass der Hüftkopf nicht gut in die Pfanne eintauchen kann. Der Wulst schlägt am Pfannenrand an. Unbehandelt kann dies über einen längeren Zeitraum zu einem vorzeitigen Verschleiß führen.
Im Rahmen einer minimalinvasiven Operation kann der Wulst am Hüftknochen entfernt werden und so der physiologische Bewegungsablauf des Gelenks wiederhergestellt werden.
Das Hüftgelenk ist das zweitgrößte Gelenk des Körpers. Bei jedem Schritt kommt es zur Belastung des Hüftgelenks. Diese alltäglichen Belastungen können in Verbindung mit weiteren Umständen zu einem Verschleiß (Arthrose) der Hüfte führen. Weitere Faktoren wie Übergewicht und Ernährung, angeborene Fehlstellung oder Schädigungen durch Unfälle können auch frühzeitig zu einem Verschleiß führen. Viele Patient*innen mit einer Arthrose haben zudem eine familiäre Belastung, das heißt, auch eine erbliche Veranlagung kommt für den Verschleiß in Betracht.
Bei einem Hüftgelenksverschleiß bestehen meist Schmerzen unter Belastung und die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Die Betroffenen beklagen oft Schmerzen im Hüftbereich und Oberschenkel. Meist kommen auch starke Schmerzen in der Leiste hinzu.
Wenn sich die Beschwerden auch nach längerer Therapie nicht ausreichend bessern, ist eine weitere Diagnostik und nach Ausschöpfung konservativer Verfahren eine operative Therapie erforderlich.
Ein Schwerpunkt unserer Abteilung ist die minimalinvasive Hüftchirurgie.
Falls die Lebensqualität durch eine ausgeprägte Arthrose des Hüftgelenks (Koxarthrose) eingeschränkt ist und die Patient*innen nicht mehr schmerzfrei gehen können oder sogar Nachtschmerzen auftreten, kann die Implantation einer Hüft-TEP (Hüft-Total-Endoprothese) hilfreich sein.
Die Operation erfolgt minimalinvasiv: Über einen kurzen Hautschnitt durch eine natürliche Muskellücke erfolgt der Zugang zum Hüftgelenk, ohne Sehnen und Muskeln durchtrennen zu müssen. Dieses OP-Verfahren führt nicht nur zu kleineren Narben, sondern verspricht auch eine schnellere Mobilität der Patient*innen. Außerdem sinkt das Risiko, dass das künstliche Gelenk auskugelt. Das Bein darf nach der Operation in der Regel voll belastet werden. Zusammen mit unseren Physiotherapeut*innen werden wir Sie nach der OP schnell wieder mobil bekommen.

Das Kniegelenk
Das Kniegelenk ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers. Es ist ein komplexes Gelenk und besteht aus vielen Strukturen. Eine Knorpelschicht auf dem Oberschenkelknochen und dem Schienbeinkopf erlaubt eine reibungslose Gleitbewegung. Dazwischen liegen zwei halbmondförmige Knorpel (Menisken), die eine Art Stoßdämpfer bilden. Die Kniescheibe hat ebenfalls einen Knorpelbezug. Sie ist notwendig, damit das Bein gestreckt werden kann. Das Gelenk wird durch die Seitenbänder und die Kreuzbänder stabil gehalten. Die Kapsel, also die Gelenkhülle, produziert eine Flüssigkeit, die das Gelenk schmiert und den Knorpel ernährt.
Jede dieser Strukturen kann erkranken oder durch einen Unfall oder Verschleiß geschädigt werden. Dies führt dann zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder zu einer fehlenden Stabilität des Gelenks.
Bei noch geringer Ausprägung des Verschleißes und entsprechender Gelenkfehlstellung kann durch sogenannte Umstellungsoperationen die mechanische Belastung des betroffenen Gelenkbereichs verringert und so das Voranschreiten des Verschleißes verlangsamt werden. Die Korrektur einer Fehlstellung erfolgt nach einer individuellen Analyse. Hierzu wird ein Röntgenbild der Beinachse digital ausgewertet und geplant, wo und an welchem Knochen korrigiert werden muss.
Bei höhergradigem Verschleiß und Beschwerden, die durch eine konservative Therapie nicht weiter gelindert werden konnten, ist die Implantation eines künstlichen Kniegelenks zu erwägen. Je nach Lokalisation und Ausprägung des Verschleißes stehen unterschiedliche OP-Techniken und Implantate zur Verfügung.
In einigen Fällen ist nur der innere Gelenkspalt durch die Arthrose befallen, der äußere Gelenkspalt und die Kniescheibe sind noch in Ordnung. Bei diesen Patient*innen kann im Rahmen eines weniger invasiven Eingriffs eine sogenannte „Schlittenprothese“ auf der Innenseite des Kniegelenks eingesetzt werden. So wird nur ersetzt, was verschlissen ist und intakte Gelenkanteile werden verschont.
In einigen wenigen Fällen, insbesondere bei Fehlbildungen oder Verletzungen der Kniescheibe, liegt eine isolierte Arthrose zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen vor. Die Patient*innen klagen über Schmerzen um die Kniescheibe herum. Es bestehen Einschränkungen beim Treppe steigen. Hinknien ist meist eine Qual.
In diesen Fällen kann ein Spezialimplantat zur Beschwerdelinderung führen. Gezielt wird die Rückfläche der Kniescheibe und das Gleitlager des Oberschenkels ersetzt, das restliche Kniegelenk bleibt erhalten.
Bei hochgradiger Arthrose des gesamten Kniegelenks und anhaltenden Beschwerden trotz konservativer Therapie können wir Ihnen durch die Implantation eines bikondylären Oberflächenersatzes (Kniegelenkstotalendoprothese, sog. Knie TEP) weiterhelfen. Im Rahmen dieser Operation wird der erkrankte Knorpel entfernt. Die Oberfläche des Kniegelenks wird ersetzt und die eventuelle Fehlstellung des Beins (O-Bein, X-Bein) korrigiert. Falls notwendig, kann auch die Rückfläche der Kniescheibe ersetzt werden.

Sportorthopädie
Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung ist die operative Behandlung von Sportverletzungen des Kniegelenks.
Typische (Sport-)Verletzungen des Kniegelenks sind u. a.
- Kreuzbandriss
- Meniskusriss
- Knorpelverletzungen
- Verletzungen der Seitenbänder
- Ausrenken der Kniescheibe, Verletzung des Halteapparats (MPFL)
- Osteochondrosis dissecans (Knochenerkrankung unterhalb des Gelenkknorpels)
Viele Operationen am Kniegelenk können mittlerweile als minimalinvasiver Eingriff im Rahmen einer Kniegelenkspiegelung erfolgen (Schlüssellochtechnik). Dies kann meist ambulant oder kurzstationär erfolgen.
Ob beim Fußball oder Skifahren: Ein Kreuzbandriss ist eine häufige und auch schwerwiegende Sportverletzung. Gelegentlich tritt der Kreuzbandriss auch bei Bagatellunfällen auf. In vielen Fällen merken die Patient*innen unmittelbar, dass im Kniegelenk etwas kaputtgegangen ist. Häufig schwillt das Kniegelenk stark an, eine Belastung ist meist nicht möglich. Aufgrund starker Schwellung und Schmerzen ist die klinische Untersuchung des Kniegelenks anfangs meist nur eingeschränkt möglich. Eine MRT-Untersuchung hilft dann bei der Diagnosestellung.
Eine operative Versorgung ist meistens indiziert. Gerade bei jungen Patient*innen mit sportlichem Anspruch sollte eine Rekonstruktion erfolgen, um wieder eine ausreichende Stabilität des Kniegelenks zu gewährleisten.
Falls bei Ihnen eine Kniegelenkverletzung von Ihrer Fachärztin/Ihrem Facharzt festgestellt wurde, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Sie ausführlich beraten und eine passende Therapie mit Ihnen besprechen.
Meniskusrisse können in jedem Lebensalter auftreten. Während in jungen Jahren häufig Sportunfälle zu Meniskusschäden führen, können im weiteren Leben auch alltägliche Bewegungen die Ursache sein, da der Meniskus mit zunehmendem Alter spröde wird.
Je nach Form und Lage des Risses sowie abhängig vom Alter der Patient*innen kann eine Naht oder eine sparsame Resektion des geschädigten Meniskusanteils erfolgen. Ziel ist es, soviel gesundes Gewebe wie möglich zu erhalten.
Bei örtlich begrenzten Knorpelschäden kann eine Reparatur des Defektes durchgeführt werden. Bei kleineren Knorpelschäden wird im Rahmen einer Kniegelenkspiegelung eine sogenannte Mikrofrakturierung vorgenommen. Hierbei wird der Knochen unter dem Knorpeldefekt angebohrt, sodass Blut mit Wachstumsfaktoren aus dem Knochen freigesetzt wird. Hierdurch kann sich ein Narbenknorpel im Defekt bilden.
Größere Defekte können unter Zuhilfenahme einer sogenannten Matrix oder durch eine Knorpelzelltransplantation im Rahmen einer kleinen Operation behandelt werden.
Gelenkwechsel (Revisionschirurgie)
Wenn bei Ihnen ausgeprägte, anhaltende Beschwerden nach der Implantation einer Knie- oder Hüftprothese bestehen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Trotz einer nachweislich geringen Komplikationsrate können verschiedene Umstände dazu führen, dass Kunstgelenke nach der Operation wie gewünscht nicht funktionieren.
- Wenn die Prothese nicht für Sie passend eingebaut wurde, kann dies zu einer schlechten Funktion des Gelenks und zu Schmerzen und Instabilität führen.
- Auch Prothesen können verschleißen. Jahre nach der Operation können durch Abnutzungserscheinungen der Prothese Beschwerden hervorgerufen werden. Die Prothese kann sich lockern, das Bein kann nicht mehr schmerzfrei belastet werden.
- In seltenen Fällen können Bakterien an die Prothese gelangen, es entsteht ein Protheseninfekt. Dies kann zu dauerhaften Schmerzen oder gar zu einer schweren Erkrankung mit Fieber und allgemeinen Symptomen führen.
Wir werden uns im Rahmen unserer Sprechstunde um Sie kümmern, uns des Problems annehmen und falls notwendig eine Wechseloperation vornehmen.
Hightech-Operationsroboter revolutioniert Kniegelenkschirurgie am UKM Marienhospital

Für Gelenkersatz am Knie setzt das Endoprothetik-Zentrum den CORI-Operations-Roboter ein
Er kommt gar nicht so auffällig daher, der leistungsstarke neue Mitarbeiter des UKM Marienhospitals. Der Roboter besteht aus einem Hochleistungs-Rechner, sensorgesteuerten Kameras, Fußpedalen für die Bedienung und vor allem dem Handgriff mit einer Präzisionsfräse an der Spitze. In den Händen von Chefarzt Dr. Christoph König ist der CORI-Operationsroboter schon deshalb so gut aufgehoben, weil der Chirurg bereits einige Jahre Erfahrung in der Kniegelenksrobotik, insbesondere mit diesem System mitbringt. „Ich freue mich sehr, dass der Roboter in Steinfurt angekommen ist und wir den Patientinnen und Patienten im UKM Marienhospital diese Leistung nun anbieten können“, so König. „Es ist der erste Roboter dieser Art in der Region, damit nehmen wir im gesamten Münsterland eine Vorreiterrolle ein. In einigen Jahren wird sicherlich die Robotik in der Endoprothetik der Standard sein.“
Die Vorteile des roboterassistierten Systems seien vielfältig, so König: „Wir planen so die Operationen viel genauer, als das bisher möglich war.“ Die Beinachse des Gelenks, also X- oder O-Beinstellungen, die Bandspannung des Innen- und Außenbandes und die patientenindividuelle Oberfläche des Kniegelenk-Knochens werden mit der Kamera-Sensor-Technik exakt vermessen und dreidimensional dargestellt. Anschließend legt der Operateur computerunterstützt fest, wie die Prothese unter Berücksichtigung der patientenindividuellen Anatomie, der Beinachse und der Bandspannung implantiert wird. Der Operateur fräst nun mit der Präzisionsfräse nur exakt so viel weg, dass die Prothese genau wie zuvor geplant implantiert wird. König: „Die Fräse an der Spitze des Roboters arbeitet auf einen halben Millimeter genau und erzeugt eine sehr glatte Oberfläche, viel ebener als bei der herkömmlichen Technik. Es kommt zum Beispiel nicht mehr zu Sägeblattabweichungen an Sklerosezonen.“
Durch die möglichst anatomische Rekonstruktion des Kniegelenks verspürt der Patient später kaum mehr ein Fremdkörpergefühl. Gleichzeitig wird durch die Messung der Bandspannung verhindert, dass nach der OP eines der kniestabilisierenden Innen- und Außenbänder zu sehr gespannt oder zu locker sind. König erklärt: „Die Fräse bedient und führt der Operateur selber, der Roboter macht nichts selbstständig. Der Roboter stoppt automatisch jedoch den Fräsvorgang, wenn die geplante Position exakt erreicht ist. Dadurch gibt es deutlich weniger Fehlimplantationen, die Operationsergebnisse zeigen ein konstant hohes Niveau.“
Eins ist dem Chefarzt wichtig: „Das handgeführte System wird immer durch einen erfahrenen Kniechirurgen gesteuert, der Roboter arbeitet also nie eigenständig.“
Expertenteam Schultergelenk

Dr. med. Tobias Schwering
Leitender Oberarzt, Hauptoperateur EPZ
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Spezielle Orthopädische Chirurgie
DVSE-Experte
Spezieller Arthroskopeur AGA Schulter
Kontakt

Priv.-Doz. Dr. med. Malte Ohlmeier
Oberarzt
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Spezielle Orthopädische Chirurgie
Spezieller Arthroskopeur AGA Schulter
Kontakt
Das Schultergelenk
Im UKM Marienhospital bieten wir das gesamte Spektrum der Schulterchirurgie an. Hierfür führen Sie mit einem der Spezialisten in der Schultersprechstunde ein erstes Arztgespräch (medizinische Anamnese). Mit der körperlichen Untersuchung und bildgebender Diagnostik wie Ultraschall, Röntgen, CT und/oder MRT können wir für Sie individuell die ideale Versorgung finden. Hierbei spielen verschiedene Faktoren wie Alter, Anspruch an die Funktion des Gelenkes und auch der Gesundheitszustand mit in die Entscheidungsfindung rein. Eine Gelenkerkrankung, die bei einem jungen Menschen auf jeden Fall (z.T. aufwendig) operativ rekonstruiert werden sollte, muss nicht automatisch auch bei einem älteren Patienten operiert werden.
Diese Entscheidung treffen sie gemeinsam mit dem Arzt in der Sprechstunde. Eine geplante Operation wird dann auch von uns Ärzten des Schulterteams persönlich durchgeführt, so dass Sie vom ersten Gespräch bis zur Entlassung nach der Operation/ ggf. Nachkontrolle immer den Spezialisten als Ansprechpartner behalten.
Die meisten Eingriffe können wir minimalinvasiv und in „Schlüssellochtechnik“ (Arthroskopie) mit nur wenige Zentimeter großen Hautschnitten durchführen. Bei einem fortgeschrittenen Verschleiß des Gelenkes, großen Sehnenrissen oder komplizierten Brüchen kann der Einbau einer Schulterprothese („künstliches Schultergelenk“) notwendig werden. Hierfür stehen modernste Implantate wie Kurzschaftprothesen, modular kombinierbare Prothesenkomponenten und ggf. eine präoperative 3D Planung zur Verfügung.

Sprechstunde Schulter
Donnerstag: 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Terminvergabe Sprechstunden:
+49 2552 79-1416
+49 2552 79-1417
Für die Versorgung von Sehnenverletzungen bieten wir minimalinvasive, arthroskopische Fadenanker Rekonstruktionen an, mit denen die Sehnen wieder befestigt werden können. Allerdings lässt sich nicht jede Art von Sehnenriss wieder nähen. Es gibt Sehnenrisse, bei denen eine Naht aufgrund von Sehnenqualität und Rissgröße nicht möglich ist. Hierfür stehen andere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die wir Ihnen in der Schultersprechstunde individuell erklären können.
Zur Stabilisierung nach Schulterluxationen (“ausgekugelte“ Schulter) greifen wir je nach Befund auf weichteilige oder knöcherne Gelenkstabilisierungen zurück, die in der Regel arthroskopisch mit Knochenankern operiert werden.
Für Schultereckgelenksprengungen (Dislokation AC-Gelenk) stehen Button-Faden-Systeme zur Verfügung, die auf Flaschenzugbasis beruhen und sowohl in mini-open Technik als auch arthroskopisch eingebracht werden können.
Frakturen des Schultergürtels können je nach Fraktur und Konstitution des Patienten/ der Patientin mittels winkelstabiler Plattenosteosynthese, Fadenankersystem oder Endoprothese versorgt werden.
Der vorzeitige Gelenkverschleiß am Glenohumeral- und Schultereckgelenk betrifft häufig Patienten/innen, mit körperlich belastenden Tätigkeiten und vor allem Über-Kopf-Arbeiten (z.B. Maler/Lackierer, Elektroinstallateure etc.). Eine schmerzhaft eingeschränkte Beweglichkeit, Kraftminderung und Nachtschmerzen sind häufige Symptome.
Die typische Behandlung der Schultereckgelenkarthrose ist die arthroskopische Erweiterung des durch den Verschleiss zu engen Gelenkes. Bringt die konservative Therapie (nicht-operative, z.B. antientzündliche Medikation, Physiotherapie, Akupunktur, Stoßwelle etc.) keine langfristige Befundverbesserung mehr kann der arthrokopische Eingriff Linderung bringen.
Die fortgeschrittene Schultergelenkarthrose (Glenohumeralarthrose/Omarthrose), die konservativ nicht mehr ausreichend behandelt werden kann, wird durch eine Schulterprothese versorgt. Hier unterscheidet man anatomische oder inverse (= „umgedrehte“) Prothesenmodelle. Entscheidend hierbei ist die Sehnenqualität der Rotatorenmanschette. Auch vor solchen Eingriffen sollte eine mehrmonatige konservative Therapie erfolgt sein und die Operation die letzte Option darstellen. Nähere Informationen zur Endoprothetik am Schultergelenk finden Sie unter dem Reiter „Endoprothetik“.
Engpasssyndrome am Schultergelenk können Sehnen und Nerven betreffen. Am häufigsten jedoch tritt das subakromiale Impingement auf, bei der die Sehne mit dem darüber liegenden Schleimbeutel unter dem Schulterdach einklemmt und so chronisch gereizt/entzündet ist. Bei längerem Bestehen kann die Sehne so auch ausdünnen oder sogar reißen.
Therapeutisch ist hier oftmals die gezielte physiotherapeutisch angeleitete Eigenübung zielführend, im Rahmen derer humeruskopfzentrierende Übungen durchgeführt werden. Sollte hierdurch langfristig keine adäquate Beschwerdelinderung erzielt werden, ist eine arthroskopische Dekompression möglich, bei der der Raum unter dem Schulterdach erweitert wird.
Entzündungsreaktionen der Schulter verlaufen typischerweise in verschiedenen Stadien und gehen vor allem in der Anfangszeit mit sehr starken Schmerzen einher, die sowohl unter Belastung als auch in Ruhe bestehen. Therapeutisch steht hierbei vor allem die Vermeidung der auslösenden Belastung im Vordergrund, verbunden mit einer gezielten konservativen (nicht-operativen) Therapie.
Sollte sich innerhalb mehrerer Monate keine Verbesserung einstellen oder ein nicht mehr erträglicher Schmerzzustand auftreten, ist eine operative Therapie indiziert. Im Rahmen dieser werden z. B. Kalkdepots eröffnet oder weichteilige Verklebungen der Gelenkkapsel gelöst. Zu beachten ist hierbei, dass postoperativ noch über einige Wochen Schmerzen bestehen können, da der Entzündungsprozess durch den Eingriff initial verstärkt wird.
Komplexe Frakturen oder ein ausgeprägter Gelenkverschleiß machen manchmal einen vollständigen Ersatz des Schultergelenks notwendig. Seit den Anfängen vor über 50 Jahren blickt die Schulterendoprothetik auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Insbesondere in den letzten 15 Jahren wurden die Prothesendesigns gezielt überarbeitet. Moderne Implantate mit meist zementfreier Verankerung sind verfügbar, die knochensparend als Kurzschaft- oder sogar schaftlose Prothesen implantiert werden können. Je nach Sehnenqualität greifen wir dabei auf anatomische oder inverse Prothesentypen zu. Diese Systeme sind modular, sodass auch von einer anatomischen auf eine inverse Prothese gewechselt werden kann im Verlauf.
Ziel der endoprothetischen Versorgung an der Schulter ist eine Schmerzreduktion und eine Funktionsverbesserung.
Auch gelockerte Prothesen können heutzutage dank hochentwickelter Revisionsimplantate gewechselt werden. Da es sich häufig zudem nur um einzeln gelockerte Komponenten handelt (z.B. nur die Pfanne oder nur der Schaft), ist oft kein kompletter Prothesenwechsel notwendig.
Weitere Informationen: Patient-Blood-Management
Das „Patient-Blood-Management“ ist ein Baustein, um die Patientensicherheit während eines Krankenhausaufenthaltes zu erhöhen. Nach dem neuen Behandlungskonzept werden bei uns im UKM Marienhospital Patient*innen behandelt, die schon vor einem Eingriff an einer Blutarmut (Anämie) leiden oder denen nach einer größeren Operation eine Anämie droht. Die körpereigenen Blutreserven von Patient*innen sollen schon bei der Planung des Eingriffs gestärkt werden. Die Patient*innen werden vor und während der Operationen speziell betreut. Mit verschiedenen Maßnahmen wird Blutarmut vorgebeugt und der Blutverlust während des Eingriffs vermieden. Hierbei wird jeder Eingriff bis ins kleinste Detail geplant.
Die Blutversorgung vor, während und nach einer OP ist wichtig, damit der Organismus optimal mit Sauerstoff versorgt wird. Dafür muss im Blut genügend Eisen vorhanden sein. Das Eisen ist Teil des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin) und wird als Hb-Wert bei einer Blutuntersuchung gemessen. Die Patient*innen mit niedrigen Hb-Werten erhalten schon vor der OP Medikamente mit den Nährstoffen, die für die Blutbildung benötigt werden. Es wird zudem darauf geachtet, dass so wenig Blutentnahmen wie möglich erfolgen.
Auch wenn moderne Operationstechniken schon blutarm sind, so kann noch während des Eingriffs mit einem sogenannten Cell Saver körpereigenes Blut der Patient*innen gesammelt und gereinigt werden. Nach der OP wird das aufbereitete Wundblut wieder in den Körper gegeben. Durch diese Form der Rückgewinnung wird weniger Fremdblut eingesetzt und es werden Komplikationen vermieden, die durch Bluttransfusion hervorgerufen werden können.
Für unser „Patient-Blood-Management“ wurden wir bereits mit dem Status „Gold“ ausgezeichnet.